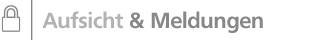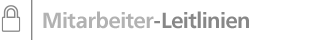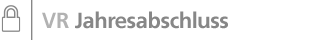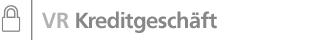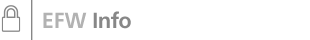Wer trifft Entscheidungen, wenn ein Mensch dazu nicht mehr in der Lage ist? Wer wird Betreuer? Und was unterscheidet Betreuung von Vorsorgevollmacht? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Was umfasst das Betreuungsrecht?
Die rechtliche Betreuung wurde am 1. Januar 1992 durch das Betreuungsgesetz eingeführt und ersetzt die frühere Vormundschaft sowie die Gebrechlichkeitspflegschaft. Sie unterstützt volljährige Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können. Die Betreuung richtet sich flexibel nach dem individuellen Bedarf, achtet auf Selbstbestimmung und beschränkt Eingriffe auf das Notwendige. Seit dem 1. Januar 2023 gelten neue praxistauglichere Regelungen, die das Selbstbestimmungsrecht stärken. Betreuer können nur für Erwachsene bestellt werden; vor allem ältere Menschen sind betroffen, aber auch Jüngere nach Krankheit oder Unfall.
Welche Aufgaben hat ein Betreuer?
Das Betreuungsgericht kann dem Betreuer je nach individuellem Unterstützungsbedarf einzelne oder mehrere Aufgabenbereiche übertragen. Diese werden genau im Gerichtsbeschluss festgelegt. Typische Aufgaben umfassen Wohnungsangelegenheiten, Vermögensverwaltung oder Gesundheitssorge.
Für bestimmte besonders eingriffsintensive Maßnahmen verlangt das Gesetz (§ 1815 Abs. 2 BGB) eine ausdrückliche gerichtliche Anordnung. Dazu zählen:
- freiheitsentziehende Unterbringungen,
- sonstige freiheitsentziehende Maßnahmen,
- die Festlegung des gewöhnlichen Aufenthalts der betreuten Person im Ausland,
- die Regelung des Umgangs mit anderen Personen,
- Entscheidungen über Telekommunikation, einschließlich elektronischer Kommunikation,
- das Entgegennehmen, Öffnen und Anhalten der Post.
Der Betreuer besitzt nur für die ihm gerichtlich zugewiesenen Aufgabenbereiche die Vertretungsmacht gemäß § 1823 BGB. Dabei soll er diese Vertretung nur insoweit ausüben, wie es notwendig ist (§ 1821 Abs. 1 Satz 2 BGB). Die betreute Person bleibt grundsätzlich handlungsfähig und kann neben dem Betreuer eigenständig rechtsgeschäftlich tätig werden, soweit es ihren Fähigkeiten entspricht und es nicht in den gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis fällt.
Stellt der Betreuer fest, dass in anderen Bereichen Unterstützung nötig ist, darf er nicht eigenmächtig handeln, sondern muss das Betreuungsgericht informieren und dessen Entscheidung abwarten. Nur in dringenden Fällen kann er als Geschäftsherr ohne Auftrag tätig werden.
Der Betreuer hat außerdem dem Gericht Umstände anzuzeigen, die eine Einschränkung oder Aufhebung der Betreuung rechtfertigen können. Bei Unsicherheit über eine Zuständigkeit ist eine Rückfrage beim Betreuungsgericht ratsam.
Mit dem Tod der betreuten Person endet die Betreuung automatisch. Der Betreuer informiert das Gericht über den Todesfall. Die Bestattung gehört nicht mehr zu seinen Aufgaben. Diese obliegt üblicherweise den nächsten Angehörigen nach Gewohnheits- oder Landesrecht. Die betreute Person kann zu Lebzeiten Bestattungswünsche äußern oder eine andere Person zur Sorge für die Bestattung benennen. Fehlen Angehörige, empfiehlt sich die Information der örtlichen Ordnungsbehörde, die meist unterstützend tätig wird.
Sie interessieren sich für das Thema Betreuungsrecht? Ein vollständiges Dossier sowie viele weitere Werke finden Sie in unserem BVR Bankenreihe. Dort bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.
Besondere Vorsorgeregelungen wie Vorsorgevollmachten oder Bestattungsvorsorgeverträge bieten weitere Möglichkeiten, Bestattung und damit verbundene Vermögensangelegenheiten im Voraus zu regeln.
Welche Arten von Betreuern gibt es?
Das Betreuungsgericht bestellt den Betreuer unter Berücksichtigung des Wunsches der betroffenen Person, sofern die vorgeschlagene Person geeignet ist und keine Interessenkonflikte bestehen. Vorrang haben ehrenamtliche Betreuer mit persönlichem Bezug – berufliche Betreuer kommen nur zum Einsatz, wenn keine geeigneten Ehrenamtlichen verfügbar sind. Personen in engem Abhängigkeitsverhältnis zur Versorgung der Betroffenen sind in der Regel ausgeschlossen. Das Gericht kann mehrere Betreuer bestellen, meist wird aber nur einer hauptberuflich tätig und vergütet. Ehrenamtliche Betreuer müssen geeignet und zuverlässig sein und Führungszeugnis sowie Schuldnerauskunft vorlegen. Berufliche Betreuer müssen seit 2023 registriert sein und persönliche Eignung, Sachkunde sowie eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Die Betreuung erfolgt nur mit Einwilligung des Betreuers, der verpflichtet ist, die Aufgabe zu übernehmen, wenn sie zumutbar ist. Ein Wechsel des Betreuers ist nur aus wichtigen Gründen möglich, beispielsweise wenn ein besser geeigneter Betreuer zur Verfügung steht oder der aktuelle Betreuer die Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.
Was ist der Unterschied zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Betreuung?
Menschen, die durch Unfall, Krankheit oder altersbedingtes Nachlassen geistiger Fähigkeiten ihre Angelegenheiten nicht mehr oder nur noch teilweise selbst regeln können, stehen verschiedene rechtliche Instrumente zur Verfügung. Eine Möglichkeit ist die Einsetzung einer gerichtlich bestellten Betreuungsperson, die im genau festgelegten Aufgabenkreis rechtliche Unterstützung leistet. Das Betreuungsrecht orientiert sich dabei am Grundsatz größtmöglicher Selbstbestimmung und richtet sich nach den Wünschen der Betroffenen.
Weiterhin kann vorsorglich eine Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt werden, um im Bedarfsfall rechtliche Belange zu übernehmen. Liegt eine solche Vorsorgevollmacht vor und erklärt sich die bevollmächtigte Person bereit, die Angelegenheiten zu übernehmen, wird keine gerichtlich bestellte Betreuung notwendig.
Zur medizinischen Vorsorge dient die Patientenverfügung. Sie regelt im Voraus, ob man bestimmten medizinischen Maßnahmen zustimmt oder sie ablehnt, falls man plötzlich nicht mehr selbst entscheiden kann.
Außerdem existiert ein gesetzliches Ehegattennotvertretungsrecht, das das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingeführt hat. Es erlaubt dem Ehepartner, in akuten Krankheitssituationen wie Bewusstlosigkeit oder Koma medizinische Entscheidungen für den nicht entscheidungsfähigen Ehepartner zu treffen.
Kann ein Betreuer über ein Konto des Betreuten verfügen?
- Betreuer dürfen über Konten verfügen, wenn ihnen die Vermögenssorge übertragen wurde,
- Die Betreuung beeinflusst nicht automatisch die Geschäftsfähigkeit des Kunden. In der Regel können sowohl Betreuer als auch Kunde Bankgeschäfte tätigen (Doppelzuständigkeit), außer bei Geschäftsunfähigkeit oder Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB),
- Zur Legitimation reicht die einmalige Vorlage des Betreuerausweises; Banken dürfen nicht wiederholt den Ausweis verlangen,
- Genehmigungspflichten: Verfügungen über Girokonten brauchen keine Genehmigung, über Sparkonten hingegen meist schon. Kunden können, wenn geschäftsfähig, selbst ohne Zustimmung verfügen, es sei denn, es besteht ein Einwilligungsvorbehalt,
- Betreuer müssen Banken über wichtige Umstände wie Geschäftsunfähigkeit oder Einwilligungsvorbehalt informieren,
- Online-Banking sollte Betreuern ermöglicht werden, vorbestehende Zugriffsrechte dürfen nicht einseitig entzogen werden,
- Haftungserklärungen für Betreuer sind gesetzlich nicht vorgesehen und dürfen von Banken nicht als Bedingung für übliche Bankgeschäfte verlangt werden.
Was kostet ein Betreuer im Monat?
Berufliche Betreuer erhalten eine Vergütung, die sich nach der beruflichen Qualifikation, der Dauer der geführten Betreuung oder nach dem Vermögen der betreuten Person richtet. Ehrenamtliche Betreuer arbeiten grundsätzlich unentgeltlich. In Ausnahmefällen kann jedoch eine Vergütung bewilligt werden.
Betreuer müssen die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Auslagen nicht aus eigener Tasche zahlen. Sie haben Anspruch auf Kostenerstattung. Dabei können sie entweder jede einzelne Ausgabe einzeln abrechnen – etwa Fahrtkosten mit 0,42 Euro pro Kilometer beziehungsweise im Falle längerer Strecken die Kosten eines öffentlichen Verkehrsmittels – oder eine jährliche pauschale Aufwandentschädigung von 425 Euro wählen. Fahrtkosten sind in der Pauschale enthalten und werden nur bei Einzelabrechnung separat erstattet. Die Pauschale gilt sozial- und steuerrechtlich als anrechnungsfrei und bis zu einem Betrag von 3.000 Euro jährlich steuerfrei.
Das Vermögen der betreuten Person stellt in der Regel die Zahlungsquelle dar. Ist die betreute Person mittellos, übernimmt die Staatskasse die Kosten.
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
- Bundesverband freier Berufsbetreuer